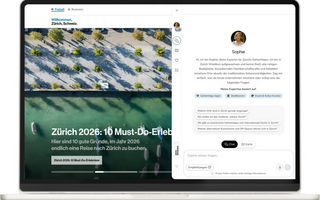Der Ansturm auf schmelzende Gletscher wird zum Problem. Laut Forscherinnen und Forschern könnte der Tourismus die fragilen Eislandschaften bedrohen, die er den Menschen eigentlich näherbringen will. Das internationale Forschungsteam unter Leitung der Universität Lausanne (Unil) beleuchtet die Widersprüche, die sich aus diesem Phänomen ergeben, in einem kürzlich veröffentlichten Kommentar in der Fachzeitschrift Nature Climate Change.
[RELATED]
Die Forschenden warnen darin davor, dass die Gletscherlandschaften von Touristinnen und Touristen «zu Tode geliebt» werden könnten, die einfach zum nächsten angesagten Reiseziel weiterziehen, sobald die Gletscher verschwunden sind.
«Last-Chance-Tourism»
Seit dem 18. Jahrhundert ziehen Gletscher Touristen an. Doch die durch den Klimawandel beschleunigte Gletscherschmelze hat das touristische Interesse in den letzten Jahren stark ansteigen lassen. «Das Bewusstsein für den Klimawandel hat Gletscher als Touristenattraktion in einem Ausmass befördert, wie es Jahrhunderte des Tourismus nie getan haben», schreiben die Forschenden.
Mehr als 14 Millionen Menschen besuchen jährlich die zehn bekanntesten Gletscherstandorte. Der Begriff «Last-Chance-Tourism» benennt dieses Verhalten, das laut den Forschenden von Alaska bis in die Alpen zu beobachten ist: Man will das Eis noch einmal sehen, bevor es verschwindet.
Touristische Anbieter reagieren laut den Forschenden darauf, indem sie das Narrativ erweitern: Wo früher vor allem die Schönheit der Gletscher im Zentrum stand, treten heute Information und Bildung stärker hinzu. So stehen vor vielen Gletschern etwa Tafeln, die ihren Rückzug quantifizieren.
Technische Flickarbeit
Um diesen Tourismusbetrieb aufrechtzuerhalten, greift die Branche zu technischen Anpassungen. Dazu gehört einerseits die Infrastruktur, die es braucht, damit Touristinnen und Touristen die Gletscher sehen können: etwa Treppen und Stege, Seilbahnen oder Helikopterflüge.
Parallel versucht die Tourismusbranche, ihre wirtschaftliche Basis mit technischen Massnahmen zu sichern. So werden Gletscherzungen teils mit speziellen Geotextilien abgedeckt, um die Schmelze zu bremsen. Oder es wird Snowfarming betrieben: Schnee wird über den Winter gelagert, um ihn im Sommer nutzen zu können.
Solche Massnahmen sehen die Forschenden kritisch. Sie seien oft profitorientiert und würden die grundlegenden Ursachen des Klimawandels nicht angehen. So könnten sie laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern notwendige Veränderungen verzögern. Zudem bergen sie Risiken einer Fehlanpassung, also von Lösungen, die kurzfristig helfen, langfristig aber neue Probleme schaffen. So können Geotextilien zu Mikroplastikverschmutzung führen, und Helikopterflüge erhöhen den CO2-Fussabdruck.
Ausserdem stellt sich laut den Forschenden die Frage danach, wer von diesem Gletscherboom profitiert. Es bestehe die Gefahr, dass lokale Gemeinschaften mit den negativen Folgen wie Wasserknappheit oder Naturgefahren alleingelassen werden, während die Gewinne an externe Akteure fliessen.
Starke Symbole für den Klimaschutz
Neben den Risiken betont das Team aber auch: Gletscher entwickeln sich auf globaler Ebene zu starken politischen Symbolen für den Klimaschutz. Als Beispiele nennen die Forschenden die Gletscher-Initiative in der Schweiz, oder eine Petition in Indien, die zum Schutz eines fragilen Ökosystems ein Kletterverbot an einem Berg durchsetzte.
Die Konfrontation mit den schwindenden Gletschern löse bei vielen Menschen emotionale Reaktionen aus. Die Forschenden sprechen von einer «ökologischen Trauer». Dieses Gefühl des Verlusts vertrauter Landschaften führe auch zu neuen Ritualen. So fanden in den letzten Jahren in Island, der Schweiz und weiteren Ländern «Gletscher-Beerdigungen» statt.
Diese Zeremonien verbinden Gedenken mit Protest und sollen das öffentliche Bewusstsein schärfen. Ob diese Erlebnisse aber zu einem dauerhaft umweltfreundlicheren Verhalten führen, ist laut den Forschenden noch unklar.
Die Forschenden betonen, dass die Entwicklung des Gletschertourismus sorgfältig beobachtet werden müsse. Es brauche mehr Forschung, um gerechte und nachhaltige Lösungen für die betroffenen Regionen zu finden. (keystone-sda)