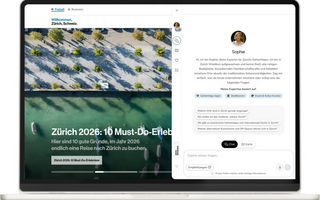Von Amelie Richter, DPA
«Dark Tourism» – dunkler Tourismus – führt Menschen an Orte, die mit Tod und Zerstörung in Verbindung stehen. Freude am Morbiden, Geschichtsinteresse oder Voyeurismus: Was lässt Touristen den Strand gegen Schlachtfelder, eine Nuklear-Sperrzone oder das Anwesen eines Drogenbosses tauschen?
75 Dollar kostet ein Ticket für vier Stunden Höllenfahrt auf den Spuren des im Gefängnis verstorbenen Sektenführers Charles Manson. Die «Helter Skelter Tour» führt zu den Tatorten einer der berüchtigsten Mordserien in den USA. Insgesamt starben im Blutrausch der sogenannten «Manson Family» sieben Menschen.
An den Tatorten
Im Kleinbus von Tour-Veranstalter Scott Michaels geht es zur dunklen Seite von Los Angeles. «Wir fahren an die Tatorte und erfahren durch Videos und Audioaufnahmen alles über die brutalen Morde», erzählt die Reiseführerin Terry Bolo. Die seltsame und entsetzliche Story sei Teil der Geschichte der Stadt. Die Tour ist oft ausverkauft.
Wer daran teilnimmt, könnte als «Dark Tourist» bezeichnet werden. Diese Touristen besuchen Orte, die mit Tod und Zerstörung zu tun haben. Der Begriff wurde 1996 von John Lennon und Malcolm Foley geprägt, zwei Tourismusforschern aus Grossbritannien. Eine genaue Definition des Begriffs sei schwer, sagt Peter Hohenhaus. Er ist selbst weit gereister «Dark Tourist» und betreibt eine Website mit Reisezielen und Tipps zum Thema. Den dunklen Tourismus gebe es in vielen Formen, erklärt er. Der Bezug zu Tod und Desaster könne dabei enger oder weiter sein.
So unterschiedlich wie die Reiseziele seien die Menschen und ihre Gründe, «Dark Tourist» zu werden. «Ich glaube kaum, dass das, was den einen dazu bringt, Orte des Ersten Weltkriegs zu besuchen, viel mit dem gemein hat, was andere zum Beispiel nach Tschernobyl oder in die vulkanischen Mondlandschaften Islands verschlägt.»
Grenze bei «Slum Tourism»
Eine Skandalisierung dieses Tourismus lehnt Hohenhaus ab. Seine persönliche Grenze setzt er aber bei «Slum Tourism», dem Besuch von Armenvierteln. «Meines Erachtens handelt es sich hierbei um etwas fundamental Anderes, zumal es nicht um geschichtliches, vergangenes Elend geht, sondern um weiterhin anhaltendes.» Was schon länger her sei, sei stets weniger problematisch, sowohl gefühlsmässig als auch kulturpolitisch, findet Hohenhaus. «Richtig schwierig wird es in ethischer Hinsicht bei gerade erst geschehenen Katastrophen.»
An manchen Orten ist jedoch nicht viel übrig, was an das Leid, das damit verbunden ist, erinnert. Zum Beispiel das einstige Anwesen des kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar ist heute ein Zoo und Freizeitpark. Der Chef des Medellín-Kartells hatte auf der Hacienda Nápoles rauschende Partys gefeiert. In einem kleinen Museum wird an die Geschichte und die Gräueltaten des Kartells erinnert. Escobar und sein Medellín-Kartell dominierten in den 1980er Jahren den internationalen Kokain-Schmuggel und waren für den Tod Tausender Menschen verantwortlich.
Selfies vor Escobars Haus
In Medellín pilgern immer wieder Touristen zu einem der Wohnhäuser von Escobar und posieren vor dem Gebäude Mónaco für Fotos. Der Stadtverwaltung passt das gar nicht. «Wenn Menschen, die so viel Schaden angerichtet haben, zu Idolen erklärt werden, dann ärgert mich das», sagt Rathauschef Federico Gutiérrez. Deshalb soll das Gebäude abgerissen werden und einem Park im Gedenken an die Opfer des Kartellbosses weichen.
Ein Element, das Touristen an diese Orte treibt, könnte die Konfrontation mit den eigenen Alpträumen sein, erklärt Dark-Tourism-Experte Hohenhaus auf seiner Website. Wie würde man sich selbst in Fall der Katastrophe verhalten? Einen anderen Ansatz bringt Philip Stone ins Spiel. Er ist Forscher am weltweit ersten Institut für Dark Tourism an der University of Central Lancashire in Grossbritannien. In westlichen säkularen Gesellschaften finde der Tod weitgehend hinter geschlossenen Türen statt. Der Dark Tourism könne einen «sozialen Filter zwischen Leben und Tod» vermitteln.
Spiel mit der Gesundheit
Bei manchen Reisezielen spielen «Dark Tourists» mit ihrer Gesundheit. Ein Hotel in Tomioka – rund neun Kilometer vom AKW Fukushima Daiichi entfernt – wird manchmal von Touristen besucht, wie ein Beamter der Stadt erklärt. «Ich denke, sie sind neugierig, was aus der Gegend um das Kraftwerk geworden ist.» Hunderttausende mussten ihre Häuser in der Präfektur Fukushima verlassen, nachdem ein schweres Erdbeben und ein anschliessender Tsunami im März 2011 die Region und das Kraftwerk stark beschädigten. Rund 18'500 Menschen kamen ums Leben.
Die Regierung hob die Evakuierungsanweisungen für die Gegend um Tomioka Ende März 2017 auf. Die meisten der einst 13'000 Einwohner sind jedoch aus Angst vor radioaktiver Strahlung nicht zurückgekommen. Online finden sich Tour-Angebote in das Gebiet. Sie werden von der Regionalregierung und Guides organisiert. Dabei stehen auch Lagerplätze für die Säcke mit kontaminierter Erde auf der Liste, verwaiste Reisfelder und Dörfer sowie ein Blick auf das AKW von einem Hügel aus. (sda dpa)